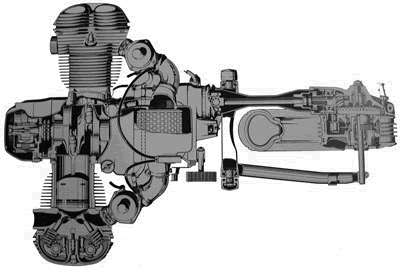Kardanantriebstechnik erklärt
Anstelle von Kette und Zahnriemen treibt beim Kardan- oder Wellenantrieb die
sogenannte Kardanwelle das Hinterrad an. Abhängig von der Einbaulage des Motors
und der Bauart der Hinterradaufhängung setzt sie sich zusammen aus einem, beziehungsweise
zwei Kreuz- oder Gleichlaufgelenken der Welle zur Kraftübertragung und, je nach
Motorlage, einem oder zwei Kegelradgetrieben.  Bei
längsliegenden Kurbelwellen kann das Drehmoment
von der Getriebeausgangswelle unmittelbar in den Sekundärantrieb eingeleitet
werden (wie auch in Animation 1).
Bei
längsliegenden Kurbelwellen kann das Drehmoment
von der Getriebeausgangswelle unmittelbar in den Sekundärantrieb eingeleitet
werden (wie auch in Animation 1). 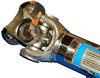
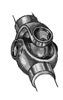 Bei
Motoren mit querliegender Kurbelwelle muß dagegen
die Kraftübertragung am Getriebeausgang um 90 Grad umgelenkt werden (Abb.2).
Motorräder mit Hinterradschwinge kommen in der Regel mit einem Kreuzgelenk (Abb.3)
aus, um die Hubbewegungen des Hinterrads auszugleichen. Es sitzt genau im Drehpunkt
der Schwinge, und da sich das Hinterrad auf einem Radius bewegt, ist auch kein
Längenausgleich erforderlich. Ein Kardanantrieb mit Momentenabstützung, wie
ihn zum Beispiel BMW bei allen Boxer-Modellen ab 1987 und bei allen K-Modellen
ab
Bei
Motoren mit querliegender Kurbelwelle muß dagegen
die Kraftübertragung am Getriebeausgang um 90 Grad umgelenkt werden (Abb.2).
Motorräder mit Hinterradschwinge kommen in der Regel mit einem Kreuzgelenk (Abb.3)
aus, um die Hubbewegungen des Hinterrads auszugleichen. Es sitzt genau im Drehpunkt
der Schwinge, und da sich das Hinterrad auf einem Radius bewegt, ist auch kein
Längenausgleich erforderlich. Ein Kardanantrieb mit Momentenabstützung, wie
ihn zum Beispiel BMW bei allen Boxer-Modellen ab 1987 und bei allen K-Modellen
ab  1988 verbaute, benötigt dagegen zwei Gelenke, da das Kegelradgetriebe zur Momentenabstützung
gelenkig mit der Schwinge verbunden ist (Abb. 4). Außerdem wird mit dieser Konstruktion
ein Längenausgleich in Form eines Schiebestücks erforderlich (Abb. 5 in der
Welle). Das BMW-System namens Paralever eliminiert
1988 verbaute, benötigt dagegen zwei Gelenke, da das Kegelradgetriebe zur Momentenabstützung
gelenkig mit der Schwinge verbunden ist (Abb. 4). Außerdem wird mit dieser Konstruktion
ein Längenausgleich in Form eines Schiebestücks erforderlich (Abb. 5 in der
Welle). Das BMW-System namens Paralever eliminiert 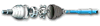 dabei
weitgehend die vom Kardanantrieb induzierten Kräfte, die beim Beschleunigen
sonst zu einer Verhärtung der Federung (Lastwechselreaktionen) führen würden.
Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Momentabstützung zwischen Hinterachsgetriebe
und Rahmen. Dazu ist das Kegelradgehäuse des Hinterachsgetriebes mit der einarmigen
Schwinge gelenkig verbunden. Im Drehpunkt dieses Gelenks überträgt ein zusätzliches
Kreuzgelenk des Kardans die Kraft ans hintere Kegelradgetriebe, dessen Gehäuse
sich über eine Schubstrebe am Rahmen abstützt.
dabei
weitgehend die vom Kardanantrieb induzierten Kräfte, die beim Beschleunigen
sonst zu einer Verhärtung der Federung (Lastwechselreaktionen) führen würden.
Im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Momentabstützung zwischen Hinterachsgetriebe
und Rahmen. Dazu ist das Kegelradgehäuse des Hinterachsgetriebes mit der einarmigen
Schwinge gelenkig verbunden. Im Drehpunkt dieses Gelenks überträgt ein zusätzliches
Kreuzgelenk des Kardans die Kraft ans hintere Kegelradgetriebe, dessen Gehäuse
sich über eine Schubstrebe am Rahmen abstützt. 
 Neben
den gebräuchlichen Kreuzgelenken werden teilweise auch homokinetische Gelenke
(Abb. 6) eingesetzt. Ihre in Laufbahnen eingebetteten Kugeln übertragen selbst
bei großen Beugewinkeln zwischen An- und Abtrieb die Drehbewegung im Gegensatz
zu Kreuzgelenken gleichförmig, und werden deshalb auch als Gleichlaufgelenke
bezeichnet. Auch bei den Kegelradgetrieben herrscht konstruktive Vielfalt: Die
einfache Geradverzahnung (Abb. 7) an den ersten Kardanmodellen wurde auf Grund
der hohen Geräuschentwicklung bald von der Schrägverzahnung (Abb. 8) abgelöst.
Heute weisen moderne Achsgetriebe Bogen- oder Spiralverzahnungen auf, deren
kontinuierlicher, überlappender Zahneingriff hohe Kräfte bei großer Laufruhe
übertragen kann.
Neben
den gebräuchlichen Kreuzgelenken werden teilweise auch homokinetische Gelenke
(Abb. 6) eingesetzt. Ihre in Laufbahnen eingebetteten Kugeln übertragen selbst
bei großen Beugewinkeln zwischen An- und Abtrieb die Drehbewegung im Gegensatz
zu Kreuzgelenken gleichförmig, und werden deshalb auch als Gleichlaufgelenke
bezeichnet. Auch bei den Kegelradgetrieben herrscht konstruktive Vielfalt: Die
einfache Geradverzahnung (Abb. 7) an den ersten Kardanmodellen wurde auf Grund
der hohen Geräuschentwicklung bald von der Schrägverzahnung (Abb. 8) abgelöst.
Heute weisen moderne Achsgetriebe Bogen- oder Spiralverzahnungen auf, deren
kontinuierlicher, überlappender Zahneingriff hohe Kräfte bei großer Laufruhe
übertragen kann.
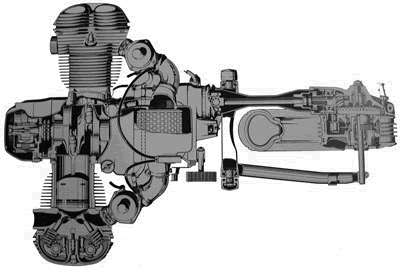
Animation 1
Zurück zum Index
 Bei
längsliegenden Kurbelwellen kann das Drehmoment
von der Getriebeausgangswelle unmittelbar in den Sekundärantrieb eingeleitet
werden (wie auch in Animation 1).
Bei
längsliegenden Kurbelwellen kann das Drehmoment
von der Getriebeausgangswelle unmittelbar in den Sekundärantrieb eingeleitet
werden (wie auch in Animation 1). 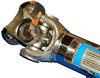
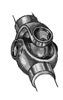 Bei
Motoren mit querliegender Kurbelwelle muß dagegen
die Kraftübertragung am Getriebeausgang um 90 Grad umgelenkt werden (Abb.2).
Motorräder mit Hinterradschwinge kommen in der Regel mit einem Kreuzgelenk (Abb.3)
aus, um die Hubbewegungen des Hinterrads auszugleichen. Es sitzt genau im Drehpunkt
der Schwinge, und da sich das Hinterrad auf einem Radius bewegt, ist auch kein
Längenausgleich erforderlich. Ein Kardanantrieb mit Momentenabstützung, wie
ihn zum Beispiel BMW bei allen Boxer-Modellen ab 1987 und bei allen K-Modellen
ab
Bei
Motoren mit querliegender Kurbelwelle muß dagegen
die Kraftübertragung am Getriebeausgang um 90 Grad umgelenkt werden (Abb.2).
Motorräder mit Hinterradschwinge kommen in der Regel mit einem Kreuzgelenk (Abb.3)
aus, um die Hubbewegungen des Hinterrads auszugleichen. Es sitzt genau im Drehpunkt
der Schwinge, und da sich das Hinterrad auf einem Radius bewegt, ist auch kein
Längenausgleich erforderlich. Ein Kardanantrieb mit Momentenabstützung, wie
ihn zum Beispiel BMW bei allen Boxer-Modellen ab 1987 und bei allen K-Modellen
ab  1988 verbaute, benötigt dagegen zwei Gelenke, da das Kegelradgetriebe zur Momentenabstützung
gelenkig mit der Schwinge verbunden ist (Abb. 4). Außerdem wird mit dieser Konstruktion
ein Längenausgleich in Form eines Schiebestücks erforderlich (Abb. 5 in der
Welle). Das BMW-System namens Paralever eliminiert
1988 verbaute, benötigt dagegen zwei Gelenke, da das Kegelradgetriebe zur Momentenabstützung
gelenkig mit der Schwinge verbunden ist (Abb. 4). Außerdem wird mit dieser Konstruktion
ein Längenausgleich in Form eines Schiebestücks erforderlich (Abb. 5 in der
Welle). Das BMW-System namens Paralever eliminiert 
 Neben
den gebräuchlichen Kreuzgelenken werden teilweise auch homokinetische Gelenke
(Abb. 6) eingesetzt. Ihre in Laufbahnen eingebetteten Kugeln übertragen selbst
bei großen Beugewinkeln zwischen An- und Abtrieb die Drehbewegung im Gegensatz
zu Kreuzgelenken gleichförmig, und werden deshalb auch als Gleichlaufgelenke
bezeichnet. Auch bei den Kegelradgetrieben herrscht konstruktive Vielfalt: Die
einfache Geradverzahnung (Abb. 7) an den ersten Kardanmodellen wurde auf Grund
der hohen Geräuschentwicklung bald von der Schrägverzahnung (Abb. 8) abgelöst.
Heute weisen moderne Achsgetriebe Bogen- oder Spiralverzahnungen auf, deren
kontinuierlicher, überlappender Zahneingriff hohe Kräfte bei großer Laufruhe
übertragen kann.
Neben
den gebräuchlichen Kreuzgelenken werden teilweise auch homokinetische Gelenke
(Abb. 6) eingesetzt. Ihre in Laufbahnen eingebetteten Kugeln übertragen selbst
bei großen Beugewinkeln zwischen An- und Abtrieb die Drehbewegung im Gegensatz
zu Kreuzgelenken gleichförmig, und werden deshalb auch als Gleichlaufgelenke
bezeichnet. Auch bei den Kegelradgetrieben herrscht konstruktive Vielfalt: Die
einfache Geradverzahnung (Abb. 7) an den ersten Kardanmodellen wurde auf Grund
der hohen Geräuschentwicklung bald von der Schrägverzahnung (Abb. 8) abgelöst.
Heute weisen moderne Achsgetriebe Bogen- oder Spiralverzahnungen auf, deren
kontinuierlicher, überlappender Zahneingriff hohe Kräfte bei großer Laufruhe
übertragen kann.